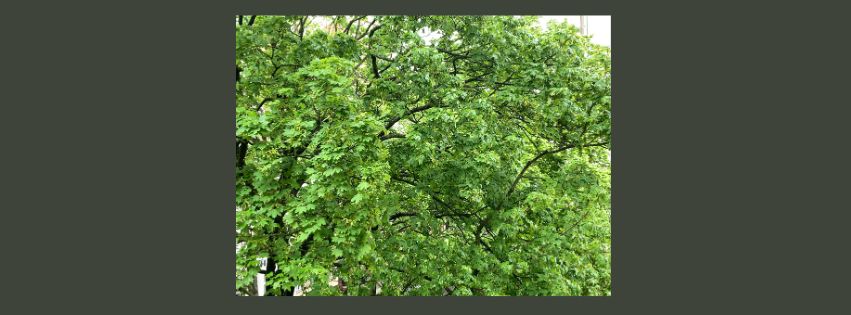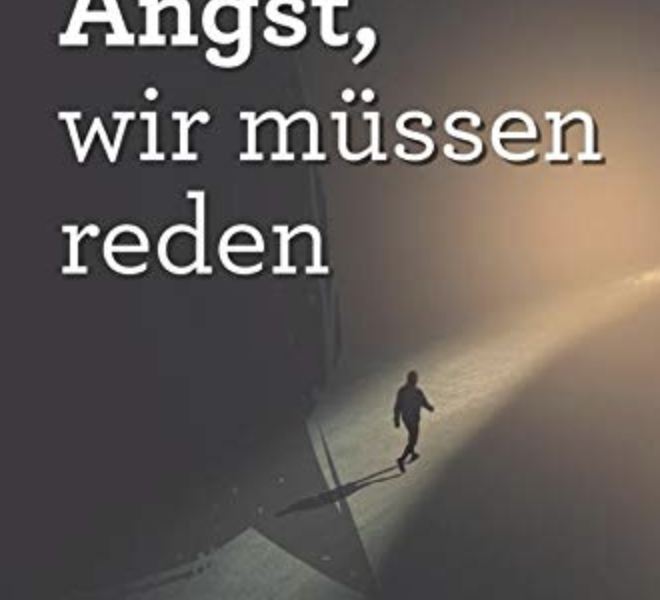| Die Ferien in meiner Kindheit habe ich überwiegend in einer Kleinstadt südwestlich von Berlin verbracht. Meine Oma wohnte in einem Mehrfamilienhaus, zu dem ein großer Garten gehörte. An den Garten schloss sich – getrennt durch einen maroden Holzzaun – eine Feuchtwiese an, die wiederum von einem Flüsschen begrenzt wurde, in dem Forellen schwammen. Eigentlich schwammen sie gar nicht so richtig. In meiner Erinnerung standen sie eher im Wasser und manchmal zuckten sie, waren plötzlich weg und tauchten an anderer Stelle wieder auf. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, wird mir immer klarer, dass sich in diesen Wochen zwischen den Schulzeiten meine Liebe und Faszination für die Natur und zu allem, was sie ausmacht, entwickelt hat. Niemand musste mir beibringen, was es bedeutet, sich verbunden und eingebunden zu fühlen. Das hat die Natur selbst erledigt. Ich bin einfach nur stundenlang im Garten gewesen, habe auf einem kleinen Hügel gelegen, der aus der Wiese herausragte, oder auf der Brücke gestanden und besagte Forellen beobachtet. Im Sommer habe ich aus Blüten Kränze geflochten, ich habe gelernt, auf welche Pflanzen man barfuß besser nicht treten oder welche man lieber nicht pflücken sollte, weil ihre feinen Härchen Hautverletzungen verursachten.Ich erkenne Insekten, Vögel, Kräuter und bis heute gerate ich in Verzücken, wenn ich Forellen in Fließgewässern stehen sehe. Wenn ich sie dann sehe, denn wie viele andere heimische Fischarten sind sie bedroht. Regulierung von Flüssen, Bebauung oder Barrieren setzen ihnen zu. Vielleicht verschwinden sie eines Tages so wie der Dünnschnabel-Brachvogel, der – wie es der Tagesspiegel heute meldet – wohl ausgestorben ist. „Ok, was hat das mit meinem Leben zu tun?“, denkst du nun vielleicht. Nie im Leben bist du diesem Vogel oder einer Forelle, die nicht in Plastik eingewickelt ist oder als „Forelle Müllerin“ auf deinem Teller liegt, begegnet. Was macht das schon, wenn eine Art verschwindet? Viel. Sehr viel, lautet die Antwort. Oder, um es mit Rachel Carson zu sagen, die das Buch „Der stumme Frühling“ geschrieben hat: „Die Geschichte des Lebens auf der Erde ist stets eine Geschichte der Wechselwirkung zwischen den Geschöpfen und ihrer Umgebung gewesen. „Niemand hat die Erde in so kurzer Zeit so massiv verändert und geformt wie der Mensch, und leider lässt er dabei jenes Prinzip, das Carson beschreibt, komplett außer Acht. Auch die Feuchtwiese gibt es nicht mehr. Dafür einen Markt, in dem man eingepacktes Fleisch aus Massentierhaltung und Forellen aus der Zucht kaufen kann. Und auch jetzt könnte man wieder sagen: Na und? Ist doch gut, wenn ich einkaufen kann.Wir haben das große Ganze aus den Augen verloren. Und leider sitzen Menschen an globalen Hebeln, die das große Ganze nicht einmal verstehen. Die nicht begreifen, dass das Verschwinden von Arten das Leben der Menschheit bedroht. Oder denen das egal ist. So wie Trump, der mal eben mit einem Federstrich Vorgaben, die die US-Umweltbehörde in Sachen Umweltschutz erlassen hatte, über Bord warf. Um noch mal den Bogen zu Rachel Carson zu schlagen: Diese Behörde wurde 1970 als Reaktion auf ihr Buch „Der stumme Frühling“ gegründet. Leider wird es nicht den einen Tag X geben, an dem plötzlich allen klar wird, dass wir die Natur nicht „zu unserer Zufriedenheit“ gestalten können. Dass wir Menschen Teil eines empfindlichen Ökosystems sind und mit massiven Folgen zu rechnen haben, wenn wir nicht damit aufhören, unsere Umwelt zu zerstören.Es ist ein schleichender Prozess. Erst ist es der Dünnschnabel-Brachvogel, dann sind es heimische Arten wie der Kiebitz oder der Alpenstrandläufer. Sind sie nicht mehr da, hat das Auswirkungen, die wir vielleicht nicht gleich sehen oder spüren, die in der Summe oder langfristig allerdings dazu führen, dass sich etwas verschiebt. Unser System ist auf dem Weg zu kollabieren, während wir über Wärmepumpen diskutieren. Als 2004 der Tsunami an die Küsten von Indonesien, Thailand und Sri Lanka zurollte, waren es die Tiere, die mit ihrem Verhalten recht früh gezeigt haben, dass Gefahr droht. Hätten mehr Menschen ihr Verhalten richtig interpretiert, hätte es weniger Tote gegeben. Die Zeichen lesen zu können, ist eine Fähigkeit, die ebenso abhanden gekommen ist wie die launischen Forellen im Bach. Abgesehen von all diesen Fakten macht es was mit uns, wenn im Frühling die Vögel nicht mehr zwitschern, die Bienen nicht mehr summen. Es wirkt sich auf unsere Psyche aus, denn wie eine aktuelle Studie belegt, macht Vogelgesang zufrieden und glücklich. Wenn ich über meinen Laptop hinweg aus dem Fenster schaue, dann sehe ich Bienen und Hummeln, die Ahornblüten umschwirren. Ab und zu kommt eine Kohlmeise oder eine Blaumeise vorbei und wippt fröhlich auf den Zweigen. Es sind weniger geworden. Als ich vor zwölf Jahren hier eingezogen bin, waren es noch mindestens fünf Brutpaare, heute sind es maximal zwei. Und die Spatzen, die damals noch die Hecken bevölkert haben, sind ganz verschwunden. Die Forellen haben mich gelehrt, das nicht hinzunehmen, mich zu engagieren, dagegen anzuschreiben. Ich will nicht, dass sie verschwinden. Ich will keinen stummen Frühling, nicht für mich, nicht für dich, nicht für uns. Denn auch wir uns vielleicht noch nie begegnet sind, so sind wir dennoch verbunden und schwimmen buchstäblich im selben Bach. |