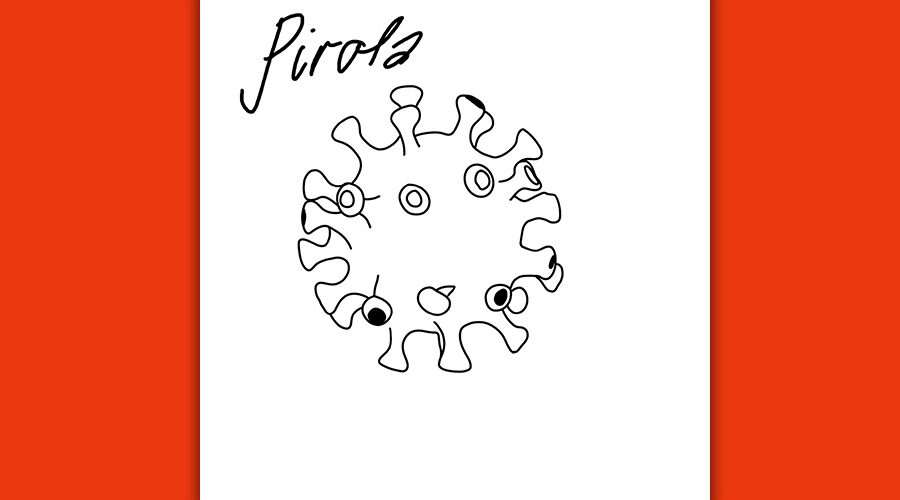Der Bestseller der Psychologin Stefanie Stahl „Das Kind in dir muss Heimat finden“ hat viele bewegt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen, bezogen auf das Treffen der Rechtsextremen in Potsdam, plädiere ich dafür, ein weiteres zu schreiben, in dem der Fremde oder das Fremde in uns thematisiert wird. Denn die Tendenz zum Rechtsextremismus, die wir derzeit in unserem Land erleben, hat auch eine psychologische Komponente.
Die Angst vor dem Fremden, der etwas spiegelt, was in uns und damit uns selbst fremd ist. Und weil dieses Fremde meist abgespalten ist, nicht angeschaut werden will, vielleicht sogar Eigenschaften verkörpert, die wir partout von uns weisen, projizieren wir es auf andere. Auf die, die uns fremd sind. Sie werden entmenschlicht, damit es leichter wird, sie zu vertreiben. All das war schon einmal da. Es ist, als würde ein Lehrbuch vor uns liegen, aus dem wir ablesen können, was passiert.
Begegnung ist der Schlüssel
Natürlich ist die Lösung komplexer, als ich es jetzt hier darstelle. Wer das vertiefen will, findet unter anderem bei Arno Gruen plausible und faktenreiche Erklärungen. Aber runter gebrochen ist es so, dass die meisten, die gegen Geflüchtete, gegen Migrant*innen oder einfach gegen „die Ausländer“ hetzen und Deportationspläne schmieden, sich selbst und dem Fremden in sich vermutlich nie wirklich begegnet sind. Und wahrscheinlich meiden sie auch den Kontakt zu allem, was ihnen fremd erscheint. Dabei wäre das ein Schlüssel: Begegnung. Wer die Geschichten der Menschen kennt, wer den Mut hat, auch selbst mal Fremder oder Fremde zu sein, der schreibt keine Hasskommentare.
In diesem Zusammenhang möchte ich eine Geschichte teilen, die ich erlebt habe, als ich 2016 als Volonteer auf Lesbos war.
Wenn aus Fremden Freunde werden
Zu Beginn der Woche auf Lesbos war ich eine Fremde. Noch nie zuvor in Griechenland, noch nie auf Lesbos, noch nie Volonteer. Ich kannte keinen aus dem Team, von Nikos, der mich am Flughafen abholen sollte, hatte ich nur ein Foto. Es ist ein seltsames Gefühl fremd zu sein. Man kommt aus seinem Kokon der Geborgenheit und betritt Neuland. Wie oft tun wir das im Leben? Uns auf etwas ganz Neues einzulassen?
Im Alltag eher selten. Vielleicht, wenn wir den Job wechseln oder in eine andere Stadt ziehen. Für die Schutzsuchenden ist das Alltag. Sie verlassen ihre Heimat, sie kommen in Lager, sie steigen in Boote, sie werden von Fremden in Empfang genommen, durch Transitzonen geschleust. Sie stehen in fremden Ländern vor Stacheldrahtzäunen, hören fremde Sprachen, sind unaufhörlich mit Herausforderungen konfrontiert. Wie behütet doch dagegen mein Fremdsein war. Wie leicht. Vielleicht weil alle, denen ich auf Lesbos im Team von Michael Räber begegnet bin, vom selben Startblock aus ins kalte Wasser gesprungen sind. Vielleicht, weil wir alle wussten, dass wir heimkehren können. Zurück in unsere warmen Wohnungen, zu unseren Familien, zu unseren Freunden.
Im Team gab es einen Mann, der selbst ein paar Monaten zuvor aus Syrien über die Ägäis nach Lesbos geflohen war. Nennen wir ihn Ahmad. Ahmad war in seinem früheren Leben IT-Berater. Hat studiert, viele Jahre in Dubai gearbeitet und kehrte nach Syrien zurück, als der Krieg längst begonnen hatte. Schon damals war er Fremder, erkannte sein Land nicht mehr.
„Wenn Du plötzlich siehst, wie Hunde auf der Straße die Leichenteile fressen, wenn deine Freunde nicht mehr leben, die die noch da sind, sich vollkommen verändert haben, dann willst du nur noch fort.“
Ahmad floh. Nicht zuletzt auch, weil das Militär ihn einziehen wollte. Ein konkretes Ziel hatte er nicht. Wie für die meisten, die flüchten, war auch für ihn das Wegkommen Ziel genug. Weit weg von all dem Grausamen, was er erlebt und gesehen hatte. Als er auf Lesbos die ersten Tage im Camp verbrachte, begegnete ihm der Helfer Michael Räber. Sie kamen ins Gespräch, aus Fremden wurden Freunde und plötzlich gab es für Ahmad eine Aufgabe. Er wurde Teil des Teams. Wenn die Boote ans Ufer kamen, konnte er mit den Menschen sprechen. Er konnte übersetzen und war damit einer von denen, die den Neuankömmlingen wenigstens ein bisschen das Gefühl geben konnten, nicht ganz so fremd zu sein.
Ich hatte mit Ahmad eine sehr berührende Begegnung. Nach einem Nachteinsatz fuhren wir zu fünft im Auto zurück Richtung Norden. Wir hatten vier Boote empfangen, waren müde. Ich saß am Steuer, Ahmad neben mir, die anderen schliefen auf der Rückbank. Irgendwann fragte ich ihn, wie es sei, dieser Moment, wenn die Menschen an Land kommen. Ob er dann an seine eigene Flucht denkt. Ahmad antwortete mir nicht, sondern schaute unentwegt auf sein Handy, das im Minutentakt unterschiedlichste Töne von sich gab. Ich wusste, dass er mich gehört und auch verstanden hatte. Sein Englisch war perfekt, viel besser als meins. Ahmad ist ein Macher. Einer, der koordiniert, vernetzt, verbindet. Sechs Wochen war er jetzt auf Lesbos und es war klar, dass er irgendwann seine Zelte abbrechen würde, um weiterzuziehen. Aber in dem Moment war er scheinbar müde, irgendwie nicht da.
„Can I drive the car?“ fragte er mich plötzlich ganz unvermittelt, während ich unser Auto Richtung Molyvos, einer wunderschönen Hafenstadt im Norden von Lesbos lenkte. Ich nickte, hielt an und wechselte mit ihm den Platz. „Then I don’t have to see the boats.“ sagte er, als der Motor wieder lief und schaute kurz zu mir herüber. Ich verstand nicht gleich, brauchte ein paar Minuten bis ich begriff, dass das die Antwort auf meine Frage war. Natürlich berührte es ihn. Natürlich weckte jedes Boot, das da an Land kam die Erinnerungen. Schnell nahm er die Kurven. So schnell, dass alle im Auto wieder aufwachten.
Zwei Tage später haben wir Ahmad am Flughafen verabschiedet. Wir haben alle geweint. Ausnahmslos. Weil wir einen Freund gehen lassen mussten, der anderswo nun wieder ein Fremder sein würde.
Ahmad hat es geschafft, dort anzukommen, wo er letztendlich sein wollte. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft für ihn bereithält, aber da, wo er jetzt ist, sind Menschen, die auf ihn gewartet und ihn unterstützt haben. Das macht mich unendlich glücklich, denn ich habe ja auch eine kleine Ahnung davon, wie es ist, fremd zu sein.