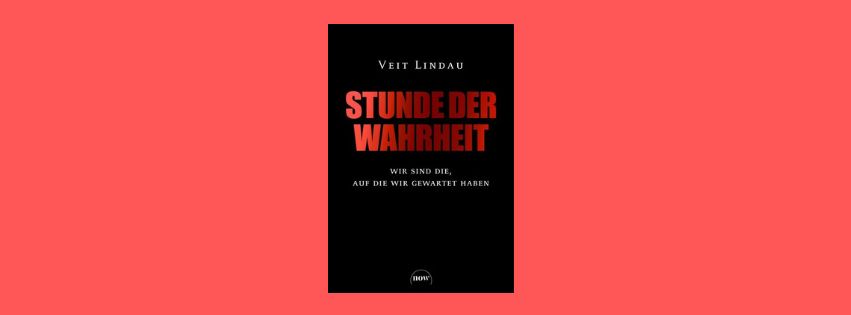Diesem Gespräch muss ich etwas voranstellen. Das Interview mit Veit Lindau habe ich im Mai dieses Jahres geführt. Wieder und wieder habe ich es mir vorgenommen, um es zu bearbeiten, aber irgendetwas in mir hat sich gesträubt. Ich habe einfach keinen Einstieg gefunden. Mal war er mir zu pathetisch, dann wieder zu kritisch, mal fand ich ihn unangemessen, ein anderes Mal saß ich minutenlang vor dem Bildschirm und hatte das Gefühl, dass mein Kopf absichtlich Nebel oder Leere produziert.
„Seltsam“, dachte ich. So ein Verhalten kannte ich gar nicht von mir. Natürlich kommt es vor, dass ich Sachen aufschiebe oder dass ich Texte mit Themen, die mir nicht liegen, mit einem gewissen Unmut bearbeite. Aber das war hier alles nicht der Fall. Im Gegenteil: Ich hatte Veit Lindau um ein Interview gebeten. Also wieso dann diese Blockade?
Mein eigener Weg hat mich ziemlich oft in Berührung mit spirituellen und esoterischen Praktiken gebracht. Es gab Zeiten, da habe ich mir Parkplätze vom Universum gewünscht, habe mir Tarotkarten legen lassen oder ausgependelt, ob ich mit einer Entscheidung richtig liege oder nicht. Ich habe in Seminaren nach dem Sinn des Lebens gefragt, habe meine Bücherregale mit Selbstoptimierungsbüchern gefüllt und habe mir von geschulten Marketinggenies einreden lassen, dass ich nur noch dieses eine Seminar brauche, um endlich meine PS auf die Straße zu bringen.
Die Krönung war, dass ich in einem mehrere tausend Euro teuren Wochenend-Event saß, umgeben von Tschakka und hohlen Versprechen und heulend das Weite gesucht habe. Mein Bedarf an Esoterik, selbsternannten Gurus und Weltrettern war also gedeckt und bezogen auf meine seltsamen Umwege hadere ich bis heute mit mir. Der kritischen Journalistin in mir sträuben sich daher mittlerweile die Nackenhaare, wenn sie mit Esoterik in Berührung kommt.
Trotzdem habe ich mich immer auch gut damit gefühlt, mit einem ganzheitlichen Blick auf Ereignisse und das Weltgeschehen zu schauen und ich habe auch nie damit aufgehört, mich selbst zu fragen, warum Wissen – also wissenschaftliches Wissen uns an vielen Stellen nicht voranbringt. Und – wo mein Platz in diesem System ist. Jedenfalls bin ich im Zuge meiner Suche schon vor vielen Jahren auf Veit Lindau gestoßen. Das war nicht schwer, schließlich ist er auf allen Kanälen sehr präsent, hat viele Bücher geschrieben und Hallen mit seinen Vorträgen gefüllt. Und ja, es gab auch Kritik, dazu später mehr.
Veit Lindau umgibt auf den ersten Blick eine leicht verdächtige Guru-Aura. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist das ein Grund, warum ich immer auch ein bisschen skeptisch geblieben bin. Gleichzeitig bin ich begeistert von seiner Arbeit. Und wahrscheinlich ist es diese Ambivalenz, die mich hat zögern lassen. Aber: Es gibt einen triftigen Grund, warum ich mir wünsche, dass mehr Menschen sich mit dem auseinandersetzen, was Veit Lindau in die Welt bringt. Auch er schaut kritisch auf so manche seiner Wege zurück, wie du im Interview lesen wirst, und aktuell ist er auf einem Pfad unterwegs, der nicht dem Zeitgeist, wohl aber der aktuellen Zeitqualität gerecht wird. Er gibt mir Antworten auf eben genau jene im letzten Absatz beschriebene Frage und bleibt dort nicht stehen, sondern zeigt Wege auf.
Vor gut einem Jahr hat er mit einem Post auf Instagram klar Stellung bezogen: „Es ist Zeit, mich bewusst und wertschätzend von einem Teil des Feldes, für das ich die letzten 30 Jahre gearbeitet habe, zu verabschieden. (…) Die Sicht auf meine Arbeit und auf die Menschen, für die ich arbeiten möchte, hat sich drastisch gewandelt.“ Bäm!!! Das war ein Bruch, der viele aus der spirituellen und esoterischen Szene, die ihm bis zu diesem Zeitpunkt gefolgt waren, erschüttert hat und Unruhe bei jenen verursacht hat, die sich zwar die tiefe Sinnsuche und das tiefe Verstehen auf die Fahne geschrieben haben, sich aber dann mit Glückskekssprüchen zufriedengaben und komplexe Wahrheiten ausblendeten oder sogar bekämpften.
Lindau hat mit seinem Bruch den Finger in die Wunde gelegt, sich selbst angreifbar gemacht beziehungsweise, wie er selbst schrieb, Steine in das eigene Glashaus geworfen. Mich hat das sehr beeindruckt. Lindau kreidet nicht nur die oft abgehobene Haltung der spirituellen Szene an, sondern auch ihr Unvermögen, Werte, die sie nach außen vertritt, wirklich zu leben.
Aber steigen wir ein.
Das Gespräch
Görlitz ist ein schmuckes Städtchen. Die Innenstadt ist pittoresk, am Grenzübergang zu Polen wird Geschichte lebendig und wenn man als Tourist über den Marktplatz schlendert, deutet wenig darauf hin, dass die AfD hier 48,9 Prozent der Erst- und 46,7 Prozent der Zweitstimmen eingefahren hat. Veit Lindau ist in Görlitz geboren, ist als junger Mann erst nach Berlin, später zusammen mit seiner Frau Andrea nach Baden-Baden gezogen, wo sie heute noch leben. In den sozialen Medien bezieht Lindau klar Stellung gegen den Populismus der AfD, abwenden will er sich von den Menschen, die sie wählen, jedoch nicht: „Weil ich viele dieser Menschen persönlich kenne – manche seit meiner Kindheit, einige sind Teil meiner Familie –, habe ich gar nicht die Wahl, mich einfach abzuwenden, sie pauschal zu verurteilen oder zu verteufeln. Schließlich kenne ich ihre Lebensgeschichten, ihre Schicksale. Das zwingt mich, im Gespräch zu bleiben. Und genau das ist heilsam. Ich lerne zuzuhören, ohne sofort zu bewerten. Natürlich ist da viel Frust, aber ich bin innerlich fast gezwungen, im Gespräch zu bleiben.“
Vor der letzten Wahl hat Veit viele Gespräche geführt, hat sich mit Argumenten vorbereitet, musste aber feststellen, dass er nicht durchdringen konnte. „Erst im Zuhören – ohne die Absicht, sie verändern zu wollen – habe ich begonnen, sie wirklich zu verstehen.“ Er weiß selbst, dass das keine Probleme löst, „aber mich schult das in Demut. Wenn ich mich in die Geschichten und Lebensumstände der Menschen versetze, kann ich wenigstens verstehen, was sie bewegt. Zum Beispiel ist die Logik vieler Wähler: »Ich wähle ja nicht die AfD, sondern ich wähle den Chrupalla. Der kommt aus Görlitz, den habe ich schon mal gesehen und der ist ganz nett.« Das kann ich verstehen.“
Und trotzdem bleibt ihm vieles fremd, weil auch er nicht mehr verstanden wird. Er soll sie in Ruhe lassen mit seinen linken Spinnereien. Veit wäre aber nicht Veit, wenn er lockerlassen würde. Die Messlatte, die er bei sich anlegt, ist sein Maßstab für andere. Es darf auch mal wehtun. Wegrennen gilt nicht. Ich kenne niemanden aus dieser Szene, der sich so konsequent selbst hinterfragt. Nicht nur, weil er verstehen will, sondern weil er die anderen nicht mit billigen Argumenten davonkommen lassen will. Und ich kenne niemanden, der für seine eigene Wahrheit in Kauf nimmt, Anhänger*innen zu verlieren. Auch dazu an anderer Stelle mehr.
„Wenn ich mich einfach abwende, dann hätten sie gewonnen. Populismus lebt von Abgrenzung. Wenn Menschen ständig hören, wie falsch, gefährlich oder dumm sie seien, macht das niemanden offen oder lernbereit – im Gegenteil. Es treibt sie noch tiefer in die Arme derer, die ihnen wenigstens das Gefühl geben, verstanden zu werden. Das beobachte ich auf AfD-Parteitagen: Die eigentliche Spaltung entsteht nicht durch ihre Ideen, sondern durch unser moralisches Überlegenheitsgefühl.“, antwortet er auf meine Frage, warum er sich nicht einfach damit abfindet.
„Diese populistische Politik funktioniert nur mit klar abgegrenzten Parteien. Aus meiner Sicht, also menschlich und psychologisch, ist es doch so: Wenn mich jemand abwertet und mir die ganze Zeit erzählt, dass ich selbst bescheuert bin und dass ich selbst gefährlich bin, dann bin ich auch nicht mehr lernwillig, sondern sage: Go and fuck yourself. Und dann treibt mich das zu denen, mit denen ich mich gut verstehe. Das ist das, was ich sehe, wenn ich mir Bilder von AfD-Parteitagen anschaue. Wenn ich mir vorstelle, du musst als Parteimitglied durch diese ganzen Menschen durch, die dich beschimpfen, also die zum Teil körperliche Gewalt anwenden, um dich davon abzuhalten, da reinzukommen. Dann wirst du nicht von etwas Besserem überzeugt, sondern du kommst da rein und da sind die Leute, die dich verstehen.
Der Effekt ist letztendlich das Gegenteil von dem, was wir mit dieser Abgrenzung erreichen wollen. Ich bin überzeugt: Gerade die sogenannten progressiven Kräfte sollten sich dringend der Schattenarbeit stellen. Oft verwechseln wir moralische Empörung mit einer ruhigen, klaren Werte-Kommunikation. Und so nähren wir selbst den Graben zwischen den Lagern – aus einem subtilen Gefühl der Überlegenheit heraus. Das ist bequem. Und es fühlt sich insgeheim sogar gut an. Aber es verhindert echte Begegnung, um zu erkennen, wo wir durch unsere moralische Abwertung lieber den Graben vertiefen und uns besser als „die anderen“ fühlen können.“
Für Veit ist der Weg, die kleinste gemeinsame Schnittmenge zu suchen: „Ich glaube an die Kraft der kleinsten gemeinsamen Schnittmenge. Ja, das ist oft frustrierend. Und es fühlt sich langsam an. Aber wenn wir diesen Weg nicht gehen, wird die Spaltung immer tiefer – und am Ende verlieren wir alle.“

Der Weg zum Experten für integrale Selbstverwirklichung und zur politischen Haltung
Ein politischer Coach? Ein Speaker, der sich ehrlich und authentisch darüber Gedanken macht, wie wir mit rechten Strömungen oder mit KI umgehen? Das ist eher unüblich in der Szene. Die meisten halten sich bedeckt, geben nichts von sich preis. Sie bleiben das weiße Tuch, auf das andere ihre Sehnsüchte und Hoffnungen projizieren können. Aber Lindau meint es ernst. Die letzten Seminare und Programme, die er veröffentlicht hat, zeigen ein ganz klares Profil. Er will Menschen nicht mehr nur persönlich an ihren Kern, sondern sie in Führung bringen. Ihnen Wege aufzeigen, wie sie all das, was sie an Wissen über Werte, Menschlichkeit, Spiritualität und Nächstenliebe gelernt haben, auch anwenden und wie sie anderen dabei helfen können, das Chaos, in dem wir gerade stecken, zu transformieren.
Lindau hat Medizin studiert, hat das Studium aber abgebrochen. Als er anfing, sich mit spirituellen Themen zu befassen, war er recht schnell der bunte Hund, denn damals gab es eigentlich kaum jemanden, der den Begriff Coach verwendete. „Ich bin nie einem Trend gefolgt. Ich habe mich immer von dem leiten lassen, was in mir gebrannt hat. Wenn etwas echt war, bin ich losgegangen – unabhängig davon, ob es gerade en vogue war oder nicht. Ich habe Medizin studiert, doch irgendwann wurde mir klar: Das bin ich nicht. Ich konnte mich nicht in einem weißen Kittel sehen, in einem System, das oft mehr verwaltet als heilt. Ich meine das nicht abwertend, sondern im Gegenteil. Ich habe tiefen Respekt vor den Menschen, die diesen Weg gehen, aber es war nichts für mich.
Also habe ich mich gefragt, was mich wirklich bewegt, und bin zu dem Schluss gekommen, dass es die Probleme des menschlichen Geistes sind. Meist beginnt meine Erforschung mit einem eigenen Problem, zum Beispiel mit einer Beziehung oder mit dem Thema Erfolg. Und dann suche ich Lösungen, und wenn die funktionieren, gebe ich sie weiter. Ich habe mir nie die Frage gestellt, wie heißt das, was ich da mache, sondern es war eher so: Wenn ich eine Lösung finde, die für mich funktioniert, teile ich sie. Nicht, denn ich denke, dass ich selbst die Wahrheit gepachtet habe, sondern denn ich weiß, wie kostbar solche Entdeckungen sind. Irgendwann haben Leute gesagt: »Veit, du musst dem einen Namen geben.« Und dann habe ich mich eben Coach genannt. Aber ich glaube, nach konservativen Definitionen betrachtet, bin ich kein Coach.
Sondern?
„Ich bin kein Coach im klassischen Sinne. Ich bin ein Fragensteller, ein Provokateur mit Herz, ein Reformer, der liebt, was wir als Möglichkeit in uns tragen und oft selbst nicht sehen. Ich bin zu leidenschaftlich für die klassische Coaching-Rolle. Neutralität liegt mir nicht. Ich will mit denen, die zu mir kommen, in den Ring steigen, nicht von außen zuschauen. Ich sehe mich als jemand, der es liebt, Potenziale zu erkennen und wachzurufen. Ich mag es, ehrliche und tiefe Entwicklungswege zu begleiten.
Eines der kostbarsten Geschenke ist es, wenn mir Menschen die Möglichkeit geben, über eine längere Zeit hinweg ihren Weg zu begleiten, weil so ist die Chance am größten ist, dass nachhaltig etwas passiert. Und ja, ich bin auch ein verkappter Prediger, finde ich. Also, wenn ich was gefunden habe, von dem ich der Meinung bin, das ist wichtig, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen, dann nerve ich auch sehr gerne liebevoll. Ich bin auch ein Visionär, der die Chance, die Öffnung, den Horizont sieht. Aber vor allem bin ich genau wie alle ein lebendiger Prozess, ein Suchender, der liebt, Fragen zu stellen und Räume zu öffnen, in denen echte Antworten geboren werden.“
Das kauft man ihm ohne Frage ab. Er war und ist bis heute der erste aus der Szene, der sich öffentlich mit KI auseinandersetzt. Nicht, indem er den Teufel an die Wand malt, sondern indem er unter anderem eindringlich fragt, was von uns bleibt, wenn KI unsere Arbeitsplätze ersetzt. Und indem er freundlich mahnt, KI nicht aus falscher Arroganz heraus zu ignorieren. Man könnte sagen, Veit und Andrea sind mit ihrem Unternehmen am Puls der Zeit. „Unsere Firma ist nicht nur ein Business, sondern unser ehrlicher, schöpferischer Ausdruck in dieser Welt. Wenn wir uns verändern, muss sich auch dieser Ausdruck verändern. Das heißt nicht, dass dies ökonomisch immer der cleverste Move ist. Doch uns beiden war Wahrhaftigkeit immer wichtiger als Erfolg. Wir sind immer dieser inneren Spur gefolgt und haben vertraut.“
Wenn du zurückblickst auf die über 30 Jahre, hast du das Gefühl, dass da noch etwas offen ist?
„Ich ahne: Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend. Vielleicht die wichtigsten meines Lebens. Vielleicht die wichtigsten für uns alle – für unsere Spezies. Die Hebel, die wir entfesselt haben, wirken einfach wahnsinnig schnell und mächtig. Als ich vor drei Jahren in einem Burnout landete, hatte ich viel Zeit, nachzudenken. Darüber, wo wir als Menschheit stehen – und wohin wir uns bewegen. Ich bin ehrlich: Da war auch eine Stimme in mir, die sagte: »Alter, such dir einfach ein stilles Plätzchen. Zieh dich zurück. Schreib vielleicht noch hin und wieder ein Buch. Und das war’s dann.« Aber ich habe gemerkt: Das geht nicht. Etwas in mir weiß: Jetzt ist die Zeit, alles in die Waagschale zu werfen. Alles, was ich bin, was ich weiß, was ich gelernt, geliebt, geirrt habe. Auch das Unbequeme. Gerade das. Ich habe das tiefe Bedürfnis, all-in zu gehen. Kein Zurück mehr. Keine halben Wahrheiten. Jetzt zählt alles.“
Und während er das sagt, sehe ich Veit Lindau, wie ihn wohl die meisten sehen: Ich sehe einen wachen Mann, dem es nie egal war, was andere über ihn denken, der sich aber trotzdem in die Arena stellt und sich einsetzt. Lindau bedient keinen Markt. Er wirft das, woran er glaubt, in den Ring und ermutigt andere, ihre eigene Arena zu finden. Das gefällt nicht allen, wie eingangs schon erwähnt. „Ich habe große Lust daran, die Szene, für die ich arbeite, aufzumischen, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich in den letzten 30 Jahren zu sehr ausgeruht hat.“
Du sagst, dass du „all-in“ gehst – aber viele engagierte Menschen sind meiner Wahrnehmung nach momentan extrem müde. Wie können wir denn wieder ins Handeln kommen, statt den Kopf in den Sand zu stecken? Wie können wir Menschen bewegen?
Erst mal zur Müdigkeit: Ich spüre sie auch. Und ehrlich – ich kenne gerade niemanden in meinem Umfeld, der sie nicht fühlt. Auch Andrea und ich – nicht als Paar, sondern in unserem gemeinsamen System – gehen gerade durch eine Reihe kleiner, aber intensiver Krisen der Läuterung. Ich glaube, genau da liegt der Spagat unserer Zeit: Auf der einen Seite geht es darum, diese alte, erschöpfende Art von Anstrengung und Kontrolle loszulassen. Auf der anderen Seite darum, wach zu bleiben – und gut für sich zu sorgen. Blinder Aktionismus bringt nichts.
Besser ist: sich ganz bewusst gutzutun – und gleichzeitig so klar wie möglich in der eigenen Wahl zu stehen. Und diese auch nach außen klar zu kommunizieren. Meine These ist sogar:
Gerade diese Erschöpfung könnte das Tor sein, uns der dringend nötigen Transformation weicher hinzugeben.“
„Und jetzt zu deiner zweiten Frage: Eine der wichtigsten – und vielleicht auch schmerzhaftesten – Erkenntnisse der letzten Jahre war für mich: Du kannst niemanden motivieren. Was wirklich funktioniert, ist: möglichst klar zu kommunizieren – in der Hoffnung, jene zu erreichen, in denen diese Visionen, Werte, dieses Potenzial bereits als Ruf angelegt ist. Das ist eine bittere Wahrheit.
Ich habe kürzlich eine Statistik gelesen, die mich wirklich nachdenklich gemacht hat:
Im psychospirituellen Bereich – also genau in dem Feld, das eigentlich für Bewusstheit stehen sollte – ist der Anteil derer, die insgeheim nur einen Fluchtweg suchen, signifikant höher als im Rest der Gesellschaft.
Wir reden hier von Menschen, die sich selbst als spirituell bezeichnen – und die Grundannahme ist ja, dass sie an Wahrheit interessiert sind. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube, dass sehr viele – oft aus kindlichen Verletzungen heraus – unter Spiritualität etwas suchen, das sie tröstet, einlullt, betäubt. Und genau diese Menschen wirst du mit unbequemen Fragen oder Fakten nicht erreichen. Im Gegenteil: Du treibst sie noch tiefer in ihre Blasen. Vielleicht – vielleicht – wenn das Wasser richtig heiß geworden ist, wächst der innere Drang nach echter Reifung. Und dann – auch nach konkreter Veränderung.“
Veit vergleicht es mit der Metapher vom Frosch, der im heißen Wasser sitzt und gar nicht merkt, dass er gleich gekocht wird. Und er beschreibt, dass er jene erreichen will, die schon auf dem Rand sitzen und nach einer Möglichkeit suchen, die anderen zu warnen und dann erst abzuspringen.
„Vor kurzem hat jemand, den ich sehr schätze, gesagt: Die Mehrheit der Menschen wird einfach in der Matrix verschwinden. Und er meinte das nicht esoterisch oder verschwörungstheoretisch, sondern ganz nüchtern: Die meisten Menschen haben keine Kraft mehr – oder keinen Willen – selbstständig zu denken. Sie lassen sich von Politikern und Medien bespaßen, von einfachen Lügen beruhigen. Und das nächste große Ding, das uns kollektiv die Flucht vor uns selbst anbietet, wird die KI sein. Auch wenn diese Aussage nicht wissenschaftlich belegt war, ich gehe stark mit ihr in Resonanz. Denn sie trifft einen Nerv. Und genau deshalb – wegen dieser unterschwelligen Ohnmacht, dieser kollektiven Erschöpfung – sprechen viele von uns gerade in einem anderen Ton.
Ich versuche, mit meiner Arbeit genau an dieser Grenze zu balancieren. Klar zu sprechen. Wach zu bleiben. Und jene anzusprechen, die am Rand stehen – zwischen Betäubung und Bewusstsein. Die bereit sind, diese Zeit wirklich persönlich zu nehmen, statt sie einfach zu überstehen. Menschen, die die Spannung aushalten zwischen Ohnmacht und Hoffnung, Stille und Wut. Die bereit sind, ihre innere Arbeit mit äußerem Engagement zu verbinden. Die mutig genug sind, die großen Eisberge zu sehen, auf die wir zusteuern – und gleichzeitig kühn genug bleiben, den offenen Horizont nicht zu vergessen. Ich spreche zu denen, die alles dafür tun, dass wir nicht in einer Dystopie landen, sondern in einer Utopie, in der wir Menschen uns selbst und dem Planeten zeigen, wozu wir im besten Sinne fähig sind.
Hast du denn den Anspruch, in wissenschaftlichen Kreisen anzukommen? Also bei denen, die deine Arbeit vielleicht sogar als Spinnerei diskreditieren?
„Ich verstehe gut, dass meine Bücher und Seminare in rational-wissenschaftlichen Kreisen erst mal auf Skepsis stoßen. Ich benutze bewusst Worte wie Sinn, Liebe oder Seele – und das reicht oft schon, um bei manchen das Eso-Alarmsystem auszulösen. Umso mehr schätze ich Menschen, die sich davon nicht gleich abschrecken lassen, sondern genauer hinschauen. Die bereit sind, sich mit der Substanz meiner Arbeit zu beschäftigen – auch mit dem wissenschaftlichen Hintergrund.
Aber: Ich bin jetzt Mitte fünfzig. Und ich habe keine Lust mehr, mich zu rechtfertigen. Mir hilft dabei die Unterscheidung in Entwicklungsphasen: prärational – rational – transrational. Wenn jemand gerade voll im Rationalen steht und dann mit transrationalen Themen konfrontiert wird, ist es fast zwangsläufig, dass er sie für Spinnerei hält. Ich werte das nicht. Ich kenne diese Phase gut – aus eigener Erfahrung. Und ehrlich gesagt: Ein Teil der Szene, in der ich mich bewege, produziert tatsächlich auch Bullshit. Ich nehme mich da nicht aus. Wenn ich auf die letzten dreißig Jahre zurückblicke, gibt es Aussagen von mir, die ich heute so nicht mehr stehen lassen würde. Ein Beispiel: die teils naive, skrupellose Verwurstung von Quantenphysik im Namen von Manifestation.
Ich finde, wir sollten einander Entwicklungs- und Lernprozesse zutrauen – und vielleicht auch mal nachfragen, bevor wir jemanden vorschnell in eine Schublade stecken. Wenn jemand zu mir kommt und sagt: „Veit, das, was du da zur Quantenphysik gesagt hast, hält wissenschaftlich nicht“, bin ich der Erste, der für so ein Feedback dankbar ist. Was ich nicht mehr mitmache, ist oberflächliches Verurteilen. Wenn mich jemand abwertet, weil eines meiner Bücher „SeelenGevögelt“ heißt, oder weil ich das Wort Spiritualität in den Mund nehme – ohne einmal nachzufragen, was ich damit eigentlich meine –, dann ist das für mich nicht konstruktiv, sondern platt.
„Ich bin jetzt Mitte fünfzig. Und ich habe keine Lust mehr, mich zu rechtfertigen.“
Veit Lindau
Wenn ich in Ruhe mit Wissenschaftler*innen sprechen konnte und erklärt habe, was ich unter Spiritualität verstehe, haben mir bisher alle zugestimmt. Weil es dabei nicht um Religion geht. Nicht um Feen oder Channelings. Sondern um die bewusste, ehrliche, mutige und immer wieder frische Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen des Lebens: Wer bin ich? Wofür bin ich hier? Was ist Wahrheit? In diesem Sinne sind manche Atheist*innen, mit denen ich gesprochen habe, spirituell viel klarer unterwegs als sogenannte Spiris, die sich ihren Glauben aus Büchern und Workshops zusammengebastelt haben.
Überhaupt glaube ich: Es würde uns allen guttun, wenn wir wieder mehr nach den 90 Prozent Gemeinsamkeit suchen würden – statt auf den zehn Prozent Differenz herumzuhacken. Denn am Ende sitzen wir alle im selben Boot. Und das steuert gerade mit hoher Geschwindigkeit auf einen sehr lauten, sehr wilden Wasserfall zu.“
Wenn man dich auf ein Panel mit Maja Göpel oder mit anderen Wissenschaftler*innen einladen würde, wärst du bereit mitzumachen?
Oh, Maja Göpel – die schätze ich sehr. Da hätte ich wahrscheinlich erst mal mit meinen eigenen Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Und ich habe ein Thema mit Panels – nicht mit den Menschen dort, sondern mit dem Format. Die meisten, die ich erlebt habe, waren nicht wirklich wirksam. Die Themen werden nur angerissen, es bleibt an der Oberfläche, und oft hat das Ganze den Beigeschmack von verbaler Positionsverteidigung. Ich neige dazu, dann eher ruhig zu werden und die anderen reden zu lassen.
Aber grundsätzlich: Ja, sehr gern. Vor allem, weil ich glaube, dass genau jetzt die Zeit ist, in der wir aufhören müssen, künstliche Gräben zu ziehen – zwischen akademisch und spirituell, zwischen wirtschaftlich und idealistisch, zwischen konservativ und progressiv. Diese Zeit verlangt nicht nach Lagerdenken, sondern nach integralen Brücken. Und ja, ich bin ein obsessiver Fan solcher Brücken. Nichts gegen unsere aktuelle Regierung – aber nach einem großen Wurf sieht das für mich im Moment nicht aus. Und wenn wir so weitermachen, ist absehbar, welches Problem wir in vier Jahren haben werden.“
Auf der Seite von eurer Stiftung habe ich die Buchstabenkombination VUCA gesehen. Magst du dazu mal was erzählen?
VUCA ist für mich eine treffende Zusammenfassung unserer Zeit. Ich spreche gern darüber, weil ich es für essenziell halte, dass wir viele der heutigen Probleme nicht nur als individuelle Herausforderungen sehen, sondern im größeren Zusammenhang verstehen – strukturell, systemisch, zivilisatorisch. Wenn ich mich umschaue, sehe ich: Fast alle sind gestresst, dünnhäutig, am Limit. Wir stehen kollektiv am Rand unserer Verarbeitungskapazität. Diese tiefe, knochenmüde Erschöpfung – fast jeder kennt sie. Aber viele beziehen sie noch auf sich selbst. Sie denken: Mit mir stimmt etwas nicht. Mit meinem Leben stimmt etwas nicht.
Ich finde, genau hier hilft das Konzept VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Es beschreibt den Strudel, in dem wir uns alle gerade bewegen – nicht metaphorisch, sondern real. Zum Beispiel dieses Gefühl, dass der Speed immer weiter zunimmt: Das ist kein subjektives Empfinden. Das ist Realität. Für mich ist VUCA deshalb auch eine unbequeme Testfrage: Stelle ich mich wirklich den wahrscheinlichsten Zukunftstrends? Bereite ich mich und meine Systeme auf sie vor? Habe ich eine geistig-emotionale Praxis, die mich befähigt, in dieser Dynamik gesund zu bleiben?
Die meisten machen einfach weiter wie bisher. Aber das ist brandgefährlich. Wir steuern auf eine Zeit zu, in der sich die Welt täglich so schnell verändern wird, wie früher in einem Monat. Das ist das neue Normal. Und ich sehe viele, die tapfer kämpfen, funktionieren, durchhalten – aber die eigentlichen Eisberge, auf die wir zusteuern, werden kaum angesprochen: Klimakrise, mentale Gesundheit, disruptive Technologien, der Zerfall alter Arbeitswelten.
Ich bin von meinem Wesen her Optimist. Doch zum ersten Mal spüre ich – neben der Hoffnung – auch große Sorgen. Was mich wirklich wütend macht, ist das kollektive Schweigen. Ich höre von all dem nichts aus unserer Regierung. Ich frage mich oft: Ihr müsst das doch sehen! Ihr müsst doch erkennen, dass wir auf eine massive psychische Krise zusteuern, gegen die Corona nur ein Aufwärmtraining war. Warum wird nicht längst in Aufklärung, in Resilienz Training, in Agilität, in mentale Beweglichkeit investiert – prophylaktisch, präventiv, langfristig?
Aber nichts davon passiert. Wir sind kollektiv nicht vorbereitet auf das, was kommt.
VUCA ist für mich längst nicht nur ein Akronym – es ist ein Synonym für die Welle, in der wir bereits knietief stehen. Und ich bin ziemlich sicher: Sie wird sich noch verstärken.“
Ich nehme Veit seine Sorge ab. Ich nehme ihm ab, dass ihn die Probleme unserer Zeit nahegehen. Dass er nicht der Zocker ist, der kalkuliert Programme entwirft, nur um Hallen zu füllen und den Menschen vorzumachen, dass sich alles auf wundersame Weise lösen wird, nur weil sie eines seiner Produkte kaufen oder den nächsten Kurs buchen.
Die Geschwindigkeit, mit der er selbst ein Programm nach dem nächsten anbietet, deutet darauf hin, dass er bemüht ist, Schritt zu halten. Manchmal hat es fast schon etwas von kindlicher Freude, wenn er etwas vor einem großen Publikum präsentiert, auf das er selbst gerade erst gestoßen ist und von dem er denkt, dass es wichtig sein könnte. Die meisten lassen sich davon anstecken. Ich selbst habe in diesem Jahr zwei Vorträge besucht und empfand die Mischung aus authentisch vorgetragener Dringlichkeit, aus wissenschaftlichen Fakten, gepaart mit Zuversicht nicht als Verkaufsveranstaltung, sondern wirklich als Denkanstoß für mich.
Es gibt allerdings andere Auffassungen über die Arbeit von Veit Lindau. Im letzten Jahr erschien ein großer Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in dem ehemalige Teilnehmer davon berichteten, dass sie verstört (psychotisch) aus einem der Seminare gekommen waren. Ich habe den Artikel gelesen. Aus journalistischer Sicht war er handwerklich nicht gut gemacht, sondern eher tendenziös. In der Inhaltsangabe zu schreiben „Manche Teilnehmer rutschen in psychische Krisen“ und sich dann nur auf zwei Menschen zu beziehen, die 2017/2019 ein Seminar besucht hatten und die nach einer ehrlichen Selbsteinschätzung nicht am Seminar hätten teilnehmen dürfen, das ist kein kritischer Journalismus.
Ich frage mich sowieso oft, mit welchem Maß gemessen wird. Kritik an dieser Szene wäre grundsätzlich dringend nötig. Aber eben, indem man genau hinschaut und nicht, indem man eine Geschichte aufbauscht, die bei genauerer Betrachtung nicht standhält.
Was sagst du zu dem Artikel, wenn du jetzt darauf zurückschaust?
„Ich denke, das war eine verpasste Chance. Für mich persönlich war es – in vielerlei Hinsicht – ein echter Leberhaken. Zum einen, weil ich wirklich geglaubt hatte, das ausführliche Gespräch mit uns über fast vier Stunden sei Ausdruck eines aufrichtigen Interesses an Wahrheit. Rückblickend war das naiv. Es hat meinen Blick auf große, sogenannte seriöse Medien nachhaltig getrübt.
Was mich aber am meisten getroffen hat, war der interne Vertrauensbruch. Dass ehemalige Mitarbeitende Adresslisten und Informationen aus sehr intimen Seminaren weitergegeben haben. Und dass – aus meiner Sicht – Menschen, denen wir aus nachvollziehbaren Gründen gekündigt hatten, genau diese Steilvorlage genutzt haben, um uns öffentlich anzugreifen.
Das hat mich tief verletzt. Und ich habe eine Weile gebraucht, um das zu verarbeiten.
Aber im Rückblick hatte das Ganze auch einen positiven Effekt. Es hat mich gezwungen, mich selbst noch einmal wirklich tief mit meiner Arbeit auseinanderzusetzen. Ich bin in Supervision gegangen, habe mich coachen lassen, viele ehrliche Gespräche geführt. Und egal, wie unfair und einseitig ich die Berichterstattung fand – es war gut. Für mich. Für unsere Arbeit. Denn ich habe mich gefragt: Was ist das Körnchen Wahrheit in der Kritik? Diese Fragen haben vieles verändert. Und vielleicht war genau das der eigentliche Wert dieser Krise.“
Was genau haben sie verändert?
„Das ist jetzt keine Ironie: Ich könnte den beiden Journalist*innen, die damals bei uns waren, heute aus tiefem Herzen einen Blumenstrauß schicken. Denn rückblickend habe ich den Wert unserer Arbeit noch einmal ganz neu schätzen gelernt. Ich habe mich meinen eigenen Blindspots gestellt, vergangene Fehler reflektiert und – hoffentlich – auch nachhaltig korrigiert. Wir haben auch die Messlatte, wer sich bei uns anmelden kann, deutlich höher gelegt.
Ich habe in dieser Zeit viel über Freundschaft und Loyalität gelernt. Es war ziemlich aufschlussreich zu sehen, wer mich plötzlich wie einen Paria gemieden hat und wer einfach still aufgetaucht ist, um mir den Rücken zu stärken. Unserer Community bin ich für die Achtung und das Feedback in dieser Zeit zutiefst dankbar.
Was ich mit „verpasster Chance“ meine, ist Folgendes: Es wäre so wertvoll gewesen, alle an einen Tisch zu holen – die ehemaligen Mitarbeitenden, die kritischen Stimmen, aber eben auch eine repräsentative Auswahl aus den tausenden zufriedenen Teilnehmer*innen. Dazu hätte ich mir sehr gewünscht, dass auch psychiatrische und therapeutische Fachleute in den Dialog einbezogen werden. Denn die, die in der Zeitung zu Wort gekommen sind, haben nicht ein einziges Mal mit mir persönlich gesprochen. Sie bekamen zehn vorformulierte Sätze vorgelegt und haben daraufhin ihre Einschätzung abgegeben.
Dabei lagen die wirklich relevanten Fragen für mich tiefer: Wie steht es um die psychische Grundverfassung unserer Gesellschaft? Wie gut ist die Versorgungslage in Therapie, Coaching, Medizin wirklich? Welche Missverständnisse und Vorurteile gibt es zwischen den verschiedenen Professionen? Und wie könnte eine integrale, verantwortungsvolle Zusammenarbeit aussehen – zwischen seriösen Coaches, Psychologinnen, Ärztinnen, Sozialpolitiker*innen?
Das wäre ein wertvoller Beitrag gewesen.
Mein Gerechtigkeitsempfinden war damals echt angekratzt. Auf der einen Seite nimmt die Süddeutsche Zeitung Geld für Anzeigen, mit denen ich meine Arbeit bewerbe. Und auf der anderen Seite zieht sie eben diese Arbeit mit reißerischen Clickbait-Formaten in den Dreck – um selbst von meiner Reichweite zu profitieren. Das empfinde ich als nicht integer. Ich musste damals echt aufpassen, dass ich nicht in Zynismus abrutsche.
Was hat euch mehr Kunden gekostet? Dieser Artikel oder dein Statement, wo du praktisch mit Teilen der spirituellen Szene gebrochen hast?
Ich glaube nicht, dass der SZ-Artikel uns Kund*innen gekostet hat, die uns wirklich kennen. Sicher, er schreckt Menschen ab, die mich nicht kennen und sich auch nicht die Mühe machen, genauer hinzuschauen. Aber unsere Arbeit ist seitdem eh noch anspruchsvoller geworden – radikaler im besten Sinne. Ich sehe das inzwischen sogar als guten Filter: Wer nicht einmal bereit ist, nachzufragen und sich selbst ein Bild zu machen, wird bei uns ohnehin nicht finden, was er sucht.
Was ich allerdings wirklich schwierig finde, ist jede Form von blindwütiger Cancel Culture. Vor kurzem haben wir mit einem großartigen, gemeinnützigen und weltweit tätigen Verein eine Spendenaktion für Frauen in Afghanistan durchgeführt. Oder ich bin auf einem international renommierten Ärztekongress aufgetreten. Und dann werden diese Organisationen für die Zusammenarbeit mit mir angegriffen – von Menschen, die kein einziges Buch von mir gelesen haben, in keinem Seminar waren, aber trotzdem meinen, sich ein Urteil erlauben zu können.“
„An solchen Stellen muss ich aufpassen, dass ich nicht selbst in eine ungute Form von Müdigkeit abrutsche. Ich würde mir sehr wünschen, dass Medien sich ihrer Verantwortung und ihrer Reichweite noch bewusster werden. Was uns tatsächlich deutlich Kundschaft gekostet hat, war unsere klare Pro-Wissenschafts- und Impfposition während der Corona-Zeit. Der Einbruch war überraschend stark – und ich stehe dazu. Das war das erste Mal, dass ich so deutlich gespürt habe, wie tief die Wissenschaftsfeindlichkeit und – sagen wir vorsichtig – Werteunklarheit in Teilen jener Szene verankert ist, für die wir damals gearbeitet haben.
Das war der Beginn einer bewussten Differenzierung – und letztlich einer notwendigen Abnabelung. Seitdem positionieren wir uns gesellschaftspolitisch klarer. Und ehrlich gesagt: Ich bin immer wieder erschreckt-fasziniert, wie viele Menschen aus der sogenannten spirituellen Szene tatsächlich rechtsaffin sind – oder Donald Trump bis heute als Lichtgestalt verehren. Das finde ich krass. Ich versuche weiter, aufzuklären und Brücken zu bauen. Aber in Teilen der Bevölkerung sind die Ressentiments so tief verankert, dass ich bezweifle, ob sie überhaupt noch erreichbar sind.
Mir tut das aufrichtig leid. Und trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, wie hartnäckig manche Verbitterung sitzt. Ich glaube, viele aus der psychospirituellen Szene haben mich in dieser Zeit als Verräter empfunden. Und manche beschimpfen mich bis heute als „linksversifft“, „woke“, „Antichrist“ – oder, mein persönlicher Favorit: „Merkels Nutte“. Und ganz ohne Ironie: Ich glaube, wir als Gesellschaft haben in der Corona-Zeit 20 bis 30 Prozent der Menschen innerlich verloren. Und ja, ich finde auch: Vieles wurde damals extrem ungeschickt, zum Teil nicht integer kommuniziert. Die massive Verunsicherung, der Kontrollverlust, die Vertrauensbrüche – das alles hat tiefe Spuren hinterlassen. Es wurde nie richtig verarbeitet. Und wenn die nächste große Krise kommt – und sie wird kommen – dann kocht das alles wieder hoch. Weil es nicht geheilt ist. Das bereitet mir wirklich Sorgen.“
Hast du selbst mal darüber nachgedacht, dich politisch zu engagieren?
„Ich bin jetzt lange genug am Leben, um meine Stärken und Schwächen realistisch einschätzen zu können. Und ich weiß: Im klassischen Politikbetrieb würde ich verschleißen. Nicht, weil ich nicht gestalten oder Verantwortung übernehmen will – im Gegenteil. Sondern weil ich nicht bereit bin, die Teile von mir zu opfern, die meine eigentliche Wirksamkeit ausmachen.
Bevor ich in so einem System auf einer Ebene angekommen wäre, auf der ich tatsächlich etwas signifikant bewegen könnte, wäre wahrscheinlich genau das, was mich ausmacht – Klarheit, Spontaneität, Radikalität im Denken – entweder abgeschliffen, korrumpiert oder zumindest stark verwässert. Ich funktioniere nicht gut innerhalb enger Parteidisziplin, hinter verschlossenen Türen oder mit vorgedachten Sprachregelungen. Ich will ehrlich sprechen dürfen. Sofort reagieren dürfen. Spüren dürfen. Und genau das geht in der Politik nur sehr bedingt – zumindest im bestehenden System.
Auch wenn ich manchmal über Politiker*innen lästere, habe ich großen Respekt vor denen, die diesen Weg aus echten Idealen gehen – und dafür enorme Opfer bringen. Aber ich selbst wäre in dieser Welt eine Katastrophe. Zu ungeduldig. Zu ehrlich. Zu impulsiv.“
Du hast ja mal ein Buch geschrieben, in dem es auch darum geht, das Bewusstsein auf das auszurichten, was man sich wünscht. Was wünschst du dir denn?
„Ich habe mich gerade wieder tiefer mit Spiral Dynamics beschäftigt und bin dabei auf einen Begriff gestoßen, der mich sehr angesprochen hat: CAPI. Das steht für die Schnittmenge von Coalesced Authority, Power and Influence – also gebündelte Autorität, Macht und Einfluss.
Wenn du Systeme wirklich verändern willst, reicht es nicht, gute Ideen zu haben. Du musst wissen, wo die echten Hebel sitzen.
Wer hat Autorität – formal wie informell?
Wer hat strukturelle Macht?
Wer hat Einfluss auf Gedanken, Gefühle, Verhalten1?
Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es das: Dass alle Menschen, die in irgendeiner Form Macht, Einfluss oder Autorität haben – egal ob in Wirtschaft, Politik, Medien, Bildung oder Spiritualität – begreifen, wie entscheidend dieser Moment ist. Ich wünsche mir, dass genau diese Menschen gemeinsam durch einen tiefgreifenden Transformationsprozess gehen. Sechs Monate. Konfrontation mit Sinn, Werten, Licht und Schatten. Keine Ausflüchte. Keine Ausreden.
Und dann – unabhängig von Parteizugehörigkeit oder Weltbild – gemeinsam an einem Anliegen arbeiten: dem Wohle aller. Nicht mehr gegeneinander. Sondern Co-Kreation statt Konkurrenz. Nicht mehr auf Kosten anderer, sondern gemeinsam mit allen. Und das bitte nicht in einer verkopften Sprache, die nur einen bestimmten Bildungshorizont erreicht. Sondern in einer Weise, die emotional anschlussfähig ist. So anschlussfähig, dass sich der Mensch, der gerade AfD wählt, genauso gesehen fühlt wie die junge, neu zugewanderte Frau, die sich fragt, ob sie hier je dazugehören wird. Ich glaube fest daran: Wenn wir eine Sprache finden, die so integrativ ist, dass sich beide darin wiedererkennen – dann beginnen echte Systeme sich zu wandeln.
Bräuchten wir eine Art Grundschulung für alle Menschen?
„Ja. All das, was wir eigentlich seit Jahrzehnten über Potenzialentfaltung, über Beziehungskompetenz, über Selbstregulation und Heilung wissen – all das, was längst schulisches Grundwissen sein müsste. Ich muss in dem Zusammenhang nochmal auf die Corona-Zeit zurückkommen. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die Regierung damals nicht gemeinsam mit Psychologinnen und Kommunikationsexpertinnen ein einfaches, gut gemachtes, öffentlich zugängliches Programm aufgesetzt hat. Ein Format, das Menschen auf Augenhöhe erklärt, was Stress eigentlich ist – und wie man damit umgehen kann. Was in Familien passiert, wenn Druck entsteht. Wie man Konflikte entschärft, statt sie eskalieren zu lassen. Ein Programm, das Menschen emotional erreicht – nicht mit pädagogischem Zeigefinger, sondern verständlich, praktisch, liebevoll. Das wäre kein Hexenwerk gewesen. Keine Raketenwissenschaft. Es wäre schlicht sinnvoll und gesund gewesen.“
Denkst du, dass es auf politischer Ebene problematisch ist, über Gefühle zu sprechen oder überhaupt sich zu erlauben, Gefühl zu haben?
„Ja, das ist sicher eines von vielen Problemen – menschlich und strukturell. Und genau das meinte ich vorhin, als du mich gefragt hast, ob ich mir vorstellen könnte, in die Politik zu gehen.
Denn bevor du in der Politik an einem Punkt ankommst, an dem du wirklich etwas gestalten kannst, hast du dich oft schon so sehr auf deine Außenwirkung konzentriert, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr im echten Kontakt mit dir selbst bist. Deine Worte sind dann vielleicht noch klug, aber nicht mehr verkörpert. Und das spüren die Menschen.
Wenn dann mal jemand wie Habeck auftaucht, der es wagt, ehrlich zu sprechen – der den Menschen komplexe, unbequeme Wahrheiten zumutet – sehen wir leider auch, wie wenig das gesellschaftlich angenommen wird. Es fehlt oft an Resonanzfähigkeit. Und wie gesagt: Das ist nur ein Aspekt von vielen. Die ganze Thematik ist hochkomplex. Deshalb glaube ich: Wir brauchen dringend integrale Räume – echte Tische, an denen diese Ebenen zusammenkommen.
Was ich in der politischen Debatte oft vermisse, ist systemische Weitsicht. Wenn man zum Beispiel mit Spiral Dynamics arbeitet – also den verschiedenen Bewusstseinsstufen innerhalb einer Gesellschaft – dann wird schnell klar: Wir sind in Deutschland nicht eine homogene Masse, sondern ein Land mit mindestens vier aktiv wirksamen Entwicklungsebenen. Jede davon hat ihre Berechtigung. Jede bringt eine Teilwahrheit mit. Wenn du eine Gesellschaft in Bewegung bringen willst, brauchst du eine Sprache, einen Impuls, eine Vision, die all diesen Ebenen gerecht wird. Einen Konsens, mit dem sich der Mehrheit identifizieren kann, ohne sich verbiegen zu müssen. Dass das nicht passiert – das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Du hast vorhin von zwei Dynamiken gesprochen, die man bräuchte. Das eine war jetzt das CAPI. Kannst du darauf noch einmal eingehen?
„Ja. CAPI – das ist die Schnittmenge aus Autorität, Power und Influence. Und was mir neben dieser strukturellen Dimension fehlt, ist etwas, das noch tiefer reicht: eine übergeordnete Vision. Eine, die groß ist. Leuchtend. Vereinend. Eine, unter der sich ein Großteil der Bevölkerung wiederfinden kann – unabhängig von Milieu, Bildungsstand oder Partei.
Was wir im Moment erleben – etwa mit der AfD – ist das Gegenteil: eine rückwärtsgewandte Vision, gespeist aus Angst und Abgrenzung. Und ganz ehrlich: Auch jemand wie Friedrich Merz hat für mich nicht die Ausstrahlung oder Tiefe eines echten Visionärs. Jemanden, der uns in die Zukunft führen könnte – mit Mut, Haltung, Weitblick. Das empfinde ich als schmerzhaft frustrierend. Auch im Blick auf das, was gerade in Amerika passiert. Da siehst du, wie eine Gesellschaft kippen kann, wenn kein überzeugendes Zukunftsbild mehr da ist, das verbindet.
Und ich frage mich: Wenn wir so weitermachen wie bisher – wo stehen wir dann in vier Jahren?“
Zum Politiker fühlst du dich nicht berufen, aber würdest du dich dazu berufen fühlen, in der ersten Reihe einer neuen Bewegung zu stehen? Ist das nicht auch ein bisschen Ziel deiner Arbeit? Oder beschränkst du dich jetzt eher auf die Menschen, die du eben mit deinen Videos und Vorträgen erreichst?
„Ich zucke bei dem Begriff „Bewegung“ immer ein bisschen zusammen. Vielleicht, weil ich ihn oft mit ideologischer Schwere oder strategischer Überfrachtung verbinde. Aber wenn du mich fragst, ob ich mich freuen würde, noch mehr Menschen zu inspirieren – absolut. Deshalb spreche ich auch öffentlich. Deshalb teile ich meine Perspektiven.
Ich bin nur nicht der Typ, der eine Bewegung anführt. Ich habe zu wenig Strategie dafür. Ich bin zu ungeduldig. Und ich glaube, ich polarisiere zu sehr mit meinen Ecken und Kanten. Aber was ich gut und sehr gern mache: Ich inspiriere. Ich unterrichte. Ich vernetze. Ich glaube, dass es jetzt vor allem darum geht, Menschen zu ermächtigen, ihren eigenen inneren Anführer zu finden. Ihnen zu helfen, sich selbst als CAPI zu betrachten, als eine schöpferische Zelle mit Autorität, Macht und Einfluss.
Denn jeder Mensch – wirklich jeder – trägt Wahrheit und Wirkungsmacht in sich. Vielleicht im familiären System. Vielleicht im Team. Vielleicht in einer lokalen Initiative. Und genau da beginnt Transformation. Nicht bei den anderen. Bei dir. Ich glaube, ich kann Menschen dabei helfen, größere Metaperspektiven so runterzubrechen, dass sie wirklich greifbar werden. Dass du verstehst: Was hat das mit mir zu tun? Was kann ich tun – hier, jetzt, in meinem Umfeld?
Ich liebe es, Menschen darin zu bestärken, an sich selbst zu glauben. Tiefer. Klarer. Und dann – aus diesem Glauben heraus – Verantwortung zu übernehmen. Da, wo sie stehen. Das Motto unserer Community-Plattform homodea tribe lautet nicht umsonst: „Starkes Ich – starkes Wir.“ Wir helfen Menschen, ihr Potenzial zu erkennen und zu entfalten – und sich dann mit Gleichgesinnten zu vernetzen.
Was ich dabei wirklich bedauere: Dass viele gute Kräfte noch immer zu wenig voneinander wissen. Oder sich – und das ist fast noch schlimmer – in Kleinkram und Empfindlichkeiten verlieren. Für diesen hypersensiblen und oft so moralisch aufgeblähten Bullshit haben wir keine Zeit mehr. Die Zeit der Einzelanstrengung ist vorbei.“
Gut, nochmal ein kleiner Sprung. Erzähl mir, was dich wirklich glücklich macht. Dich persönlich.
„Stille. Wenn ich meditiere oder einfach mal spazieren gehe und es schaffe, den Kopf auszuschalten, dann entsteht Raum. Ich lerne sehr, sehr gern dazu und forsche zu meinen Lieblingsthemen. Eine tiefe Quelle von Freude ist auch die Beziehung zu meiner Frau. Das ist der Jackpot. Die Liebe zu den Menschen, die mir wirklich sehr, sehr, sehr viel bedeuten, macht für mich einen riesigen Unterschied. Und meine Arbeit beseelt mich natürlich. Ich empfinde es als Gnade, dass ich seit über 30 Jahren meine Arbeit immer wieder weiterentwickeln und mit meinem eigenen Reifungsweg synchronisieren kann. Dass ich nicht eine Rolle spielen muss, sondern in meinem Beruf wachsen darf. Und dass so viele Menschen bereit sind, sich auf meine Impulse einzulassen – das ist keine Selbstverständlichkeit.
Je älter ich werde, desto mehr weiß ich auch die kleinen, stillen Dinge zu schätzen. Ein gutes Essen. Ein echtes Gespräch. Ein befreiendes Lachen. Ich finde, dieses Leben auf diesem kleinen grün-blauen Planeten schenkt uns so viele Wunder – wenn wir still genug werden, um sie zu sehen.“
Veit spricht noch davon, wie sehr ihn auch die aktuelle Zerstörung der Natur in Hinblick auf die Zukunft bewegt und weil mich das Thema auch berührt, erzähle ich Veit von meinen Erfahrungen. Davon, dass es, als wir vor vielen Jahren in unsere Wohnung gezogen sind, noch eine Spatzen-Kolonie in den Büschen vor unserem Haus gab. Und dass es jetzt im Frühjahr viel ruhiger ist. Ich frage ihn, wie es kommt, dass andere das nicht auch sehen oder wahrnehmen. Dass das doch der gemeinsame Nenner sein könnte, die Natur zu erhalten. Warum verstehen das andere nicht?
„Darf ich das als Beispiel nutzen?“, fragt Veit.
Diesen Reflex kenne ich natürlich auch: sich zu fragen, warum die anderen es nicht sehen. Warum sie es nicht fühlen. Und auch hier hilft mir mein Wissen über Entwicklungspsychologie. Das klingt vielleicht technisch, aber im Kern geht es um eine einfache Frage: Aus wie vielen Perspektiven kannst du die Welt wahrnehmen?
Die erste Ebene ist die Ich-Perspektive: Ich sehe das, was mich direkt betrifft. Die meisten Menschen schaffen es gerade noch zur nächsten Ebene – sie können sich mit etwas Anstrengung in ihre Nächsten hineinversetzen: Partner, Kinder, enge Freunde. Aber darüber hinaus wird es schnell dünn. Und wenn jemand diese weitere Perspektive noch nicht ausgebildet hat, dann hat er sie eben nicht. Punkt. Das ist wie bei einem dreijährigen Kind: Du kannst ihm erklären, was Mitgefühl ist, aber es wird es nicht wirklich verstehen – weil die neurologische Grundlage dafür noch nicht da ist.
Und genau das macht für mich vieles verständlicher. Zum Beispiel, warum Politiker mit bestimmten Botschaften scheitern – weil sie Menschen ansprechen wollen, die schlicht (noch) keine Sprache dafür haben. Sie senden auf einer Frequenz, die viele nicht empfangen können.
Wenn ich öffentlich über diese Dynamiken spreche, höre ich oft: „Das klingt überheblich.“
Aber das ist keine Arroganz – das ist Entwicklungspsychologie. Und sie ist messbar. Ich habe es an anderer Stelle schon angedeutet: Ich verstehe wirklich nicht, warum dieses Wissen nicht viel konsequenter in Politik, Bildung und öffentlicher Kommunikation genutzt wird. Warum bringen wir Menschen nicht systematisch bei, im Lauf ihres Lebens mehr Perspektiven einnehmen zu können?
Stattdessen verlassen viele mit 16 oder 18 Jahren die Schule und bleiben dann bis ins hohe Alter auf genau demselben mentalen Betriebssystem stehen. Dann wundert es mich nicht, wenn ein AfD-Wähler nicht erkennt, wie ausgrenzend und herablassend in seiner Partei über Muslime gesprochen wird. Das ist – mit wenigen Ausnahmen – kein böser Wille. Es ist schlicht ein Mangel an entwickelter Perspektivfähigkeit. Und das nutzen geschickte Populisten wie Weidel oder Söder gnadenlos aus. „Wir lassen uns unsere Weißwurst nicht von den Grünen wegnehmen!“ – das ist so absurd wie wirkungsvoll. Es funktioniert, weil es dort andockt, wo einfache Botschaften emotional Sicherheit bieten.
Ich habe Achtung und Mitgefühl für jemanden wie Habeck. Ich habe ihn nie persönlich getroffen, aber ich nehme ihm seine Integrität ab. Sein Bemühen, Komplexität begreiflich zu machen – das war redlich, authentisch, nachvollziehbar. Aber gleichzeitig war für mich klar: Damit wird er bei vielen nicht durchkommen. Er erreicht die, die ihn ohnehin gewählt hätten. Und der Rest sagt: „Was willst du mit deiner komischen Sprache – sag einfach, was Sache ist.“
Wenn du die Schulen verändern könntest, wie würde das aussehen?
„Heißes Thema. Vielleicht das heißeste überhaupt. Denn unsere Kids und unsere Zukunft sind heilig. Ich würde die Schulen anhalten. Ernsthaft. Ich würde ein Moratorium ausrufen – nicht einfach weitermachen, sondern Raum schaffen. Raum, um innezuhalten und zu fragen: Was machen wir hier eigentlich? Ich würde zu den Schüler*innen sagen: „Wisst ihr was? Für ein halbes Jahr pausieren wir den klassischen Unterricht. In dieser Zeit reden wir darüber, was in der Welt passiert. Wir lernen gemeinsam, wie man Gefühle fühlt und versteht. Wie man konstruktiv-kritisch denkt. Wie man Werte definiert. Und in derselben Zeit machen wir das auch mit den Lehrerinnen – und mit den Eltern.
Parallel dazu setzen sich die klügsten und weisesten Köpfe zusammen – nicht politisch motiviert, sondern wirklich integrativ – und gehen in eine Co-Kreations-Klausur: Was müssen unsere Kinder heute lernen? Und wie?
Wenn ich – Stand heute – ein Kind hätte, ich würde es wahrscheinlich aus dem System nehmen. Weil die Fähigkeiten, die unsere Kinder in zwei, drei Jahren brauchen werden, nicht das sind, was ihnen aktuell vermittelt wird. Das klingt vielleicht hart oder überheblich, aber ich glaube: Ein Großteil dessen, was heute noch gelehrt wird, ist vergeudete Lebenszeit.
Worum es wirklich gehen müsste? Disziplin. Konstruktiv-kritisches Denken. Emotionale Intelligenz. Soziale Intelligenz. Medienkompetenz. Wie gehe ich mit KI um, ohne mich ihr zu unterwerfen? Wie treffe ich Entscheidungen, wenn alles komplexer wird? Das sind überlebensnotwendige Skills. Und ja, natürlich brauchen wir auch Mathematik, Logik, Ethik, Ästhetik – aber als Grundlagen, nicht als toten Stoff. Was wir stattdessen oft lehren, ist absurdes Detailwissen – fern der Lebensrealität.
Ich verneige mich vor allen, die heute noch als Lehrer*innen in die Schule gehen. Für mich ist das Bildungssystem eines der Systeme mit den meisten offenen Fragen – und zugleich eines, das sich am langsamsten verändert. Gerade in jener Phase, in der das Gehirn am formbarsten ist, pumpen wir es mit Daten voll – statt uns zu fragen: Welche Kompetenzen braucht ein junger Mensch wirklich? Und wie kann man sie trainieren? Ethisches Denken. Achtsamkeit. Selbstreflexion.
Ich habe neulich gelesen, dass über 60 Prozent der Jugendlichen ihre Gefühle lieber einer KI anvertrauen als einem Menschen. Und ehrlich – ich verstehe das total. Ich selbst lasse mich derzeit auch nicht mehr ausschließlich von einem Menschen coachen. Das ist die neue Realität. Und die wird nicht mehr verschwinden.“
_____________________________________________________________________________________
An dieser Stelle haben wir unser Gespräch beendet. Nicht, weil wir keine Themen mehr gehabt hätte, sondern weil gerade das Thema Schule abendfüllend ist. Und weil man nicht alles in ein Interview packen kann. Jetzt, da ich unser Gespräch verarbeitet habe, ist meine eingangs beschriebene Ambivalenz verschwunden.
Ich folge nicht allem, was Veit Lindau in seinen Programmen anbietet. Und ich sehe auch weiterhin die Gefahr, dass Menschen sich in der Sinnsuche verlieren – oder verrennen. Dass sie, wie ich selbst früher, von einem Programm zum nächsten laufen, auf der Jagd nach der nächsten „Erleuchtung“.
Aber ich sehe auch: Die rationale Weltsicht, die unser Denken in den letzten Jahrhunderten geprägt hat – diese kühle, funktionale Art, Fühlen und Sinnfragen entweder zu ignorieren oder als esoterische Spinnerei abzutun – ist ein Grund dafür, dass wir uns so sehr von uns selbst und von der Natur entfremdet haben.
Insofern sei die Frage an all jene erlaubt, die solche Programme oder Wege pauschal verteufeln:
Was genau ist eigentlich so schlimm daran, sich den eigenen Gefühlen zu stellen? Visionen zu entwickeln? Sich ernsthaft zu fragen: Wer bin ich? Was will ich geben?
Wovor habt ihr Angst? Wir sind denkende UND fühlende Wesen. Wir irren. Wir verletzen. Wir werden verletzt. Wir tragen Schatten in uns. Sich diesen Anteilen zuzuwenden, statt sie wegzudrücken, wäre vielleicht ein Anfang.
Ein Anfang für echte Veränderung.
Ich danke Veit Lindau von Herzen für dieses Gespräch.
Hier ist übrigens seine Antwort, nachdem er den Text gegengelesen hat:
Liebe Jeannette, weiß nicht, ob du das mit veröffentlichen möchtest:
Als ich dein Vorwort gelesen habe, musste ich schmunzeln. Ich bin vieles, aber ganz sicher kein Guru. Ich schätze deine ehrliche Äußerung deiner Ambivalenz, diesen inneren Spagat zwischen kritischem Geist und offenem Herz. Ich möchte dir an dieser Stelle danken.
Nicht nur für das Interview – sondern für unsere leise Verbindung über eine längere Zeit. Ich weiß, du kommst aus einer ganz anderen Welt als ich und beäugst, was ich tue, kritisch. Und gerade deshalb schätze ich es sehr, dass du trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – immer wieder den Kontakt gesucht hast. Offen. Ehrlich. Neugierig. Auch wenn wir uns kaum kennen, ist dies für mich ein gelebtes Beispiel für das, was ich mit „integrale Beziehung“ meine. Wenn zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Biografien und Weltzugängen sich nicht nur tolerieren, sondern auch echt zuhören und voneinander lernen. Auf Augenhöhe.
Danke dir für das aufmerksame Gespräch.
Herzlich,
Veit
Ich habe Veit zum Abschluss noch gefragt, ob er ein weiteres Buch schreiben wird. Wie eingangs bemerkt, haben wir das Interview im Mai aufgenommen. Jetzt haben wir November, das Buch ist im Druck und ich habe die Möglichkeit, drei Exemplare zu verlosen. Das Buch wird am 25. November erscheinen. Mehr dazu hier: Link: https://jeannette-hagen.de/news/verlosung-stunde-der-wahrheit/
Du willst meine Arbeit unterstützen? Dann hast Du die Möglichkeit, hier ein Abo abzuschließen -> https://jeannette-hagen.de/abo/ oder Du kannst mir per PayPal einen von Dir ausgewählten Betrag unter diesem LINK spenden.