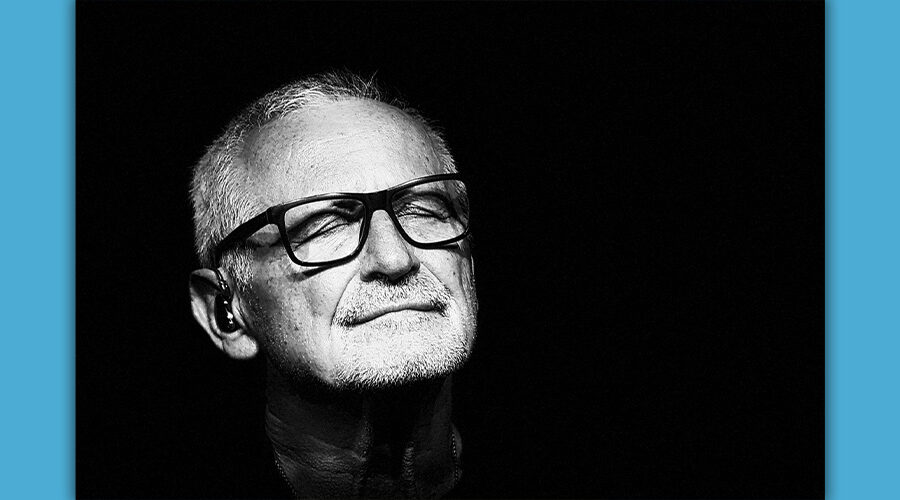auch als eBook erhältlich
„Die verletzte Tochter“ ist ein sehr persönliches Buch und trotzdem auch ein Sachbuch. Es geht um ein Phänomen, das viele Menschen betrifft – um Vaterentbehrung. Ich erzähle einen Teil meiner eigenen Geschichte und habe darüber hinaus viele Fakten zusammengetragen, die aufzeigen, welche weitreichenden Folgen Vaterentbehrung für den Einzelnen und die Gesellschaft hat. Und ich zeige, wie wir aus der Opferrolle herausfinden und das, was wir uns immer vom Vater gewünscht hätten, in uns finden können: ein bedingungsloses Ja zu uns selbst. Für eine Leseprobe gehen Sie bitte auf „Aktuelles“ und klicken auf das Buchcover.